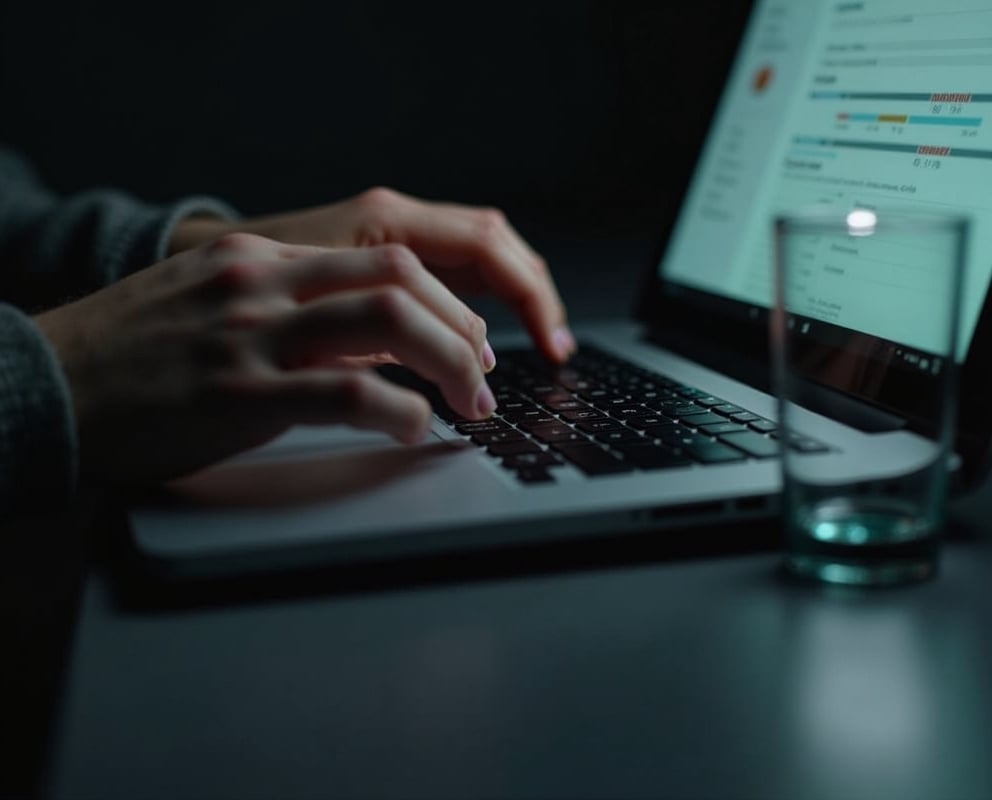Diversifikation in der Praxis
Diversifikation beschreibt die Verteilung von Anlagen über unterschiedliche Merkmalscluster, um Abhängigkeiten sichtbar zu machen und Konzentrationsrisiken zu vermeiden. In der Praxis bedeutet das, Korrelationen, Branchen- oder Länderfaktoren sowie Währungsbezüge als getrennte Dimensionen zu dokumentieren. Eine einfache Startfrage lautet, ob einzelne Positionen im Verhältnis zur Gesamtstruktur übergewichtet sind und wodurch diese Gewichtung entstanden ist. Als neutrale Darstellungsform können gleichgewichtete und merkmalsbasierte Gewichtungen gegenübergestellt werden, um Unterschiede in der Streuung zu erkennen. Entscheidend ist die nachvollziehbare Dokumentation der Annahmen, damit spätere Vergleiche möglich bleiben. Prognosen über Ergebnisse werden nicht getroffen; die Beschreibung dient ausschließlich dem Verständnis der Begriffe und Zusammenhänge.